Digitaler Detox gescheitert
Können wir noch aufs Handy verzichten? «Sommergäste», ein altes Stück neu geschrieben, stellt im Theater Basel diese Frage und beantwortet sie mit einem klaren Nein.

Die «Sommergäste» treffen sich zum «Retreat». Ein paar Tage in den Bergen ohne Computer, ohne Handy, ohne Internet, ein «Break» im täglichen Berufsstress, das wird doch gut tun? Da sind ein Anwalt für digitale Transformation, eine Lektorin, ein gescheiterter Soziologiestudent, ein Arzt, eine Psychologin, eine IT-Spezialistin und andere. Und sie alle scheitern.
Digitaler «Detox» erweist sich als unmöglich. Das Handy ist ein Tyrann. Alle müssen ständig präsent, verfügbar und vernetzt sein. Und wer im Nahkampf der Ehe und der Beziehungen die Überwachungsmöglichkeiten der neueren Medien nicht nutzt, der hat schon verloren. Das Stück «Sommergäste» endet mit einer flehentlichen Bitte, einem Verzweiflungsschrei: «Eine kleine Pause!»
Der Bittere und der Tausendsassa
Wer will, kann in der Geschichte des Stückes ein Geheimnis rund um die Zahl vier entdecken: 1904 erregte der sozialistische Autor Maxim Gorki (russisch für «der Bittere») in Petersburg mit der Uraufführung des Stückes «Sommergäste» einen Skandal und provozierte Demonstrationen für seine Befreiung aus zaristischer Gefangenschaft.
1974 entriss der Regisseur Peter Stein in Berlin das Stück in einer Neufassung von Botho Strauss dem Vergessen – es wurde eine nachhaltig wirksame Jahrhundertinszenierung. Und nun 2024, 120 Jahre nach der Uraufführung und 50 Jahre nach Peter Stein, bringt der Regisseur Stefan Pucher eine «Überschreibung» von Dietmar Dath ins Basler Theater.

Pucher und Dath sind ein interessantes Duo. Dietmar Dath, Jahrgang 1970, ist ein extrem produktiver und vielseitiger kritischer Intellektueller und Künstler. Ein Tausendsassa. Er ist marxistischer Antikapitalist und gleichzeitig Redaktor im Feuilleton der bürgerlichen Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das muss einer erst mal zusammenbringen. Er ist der wohl profundeste lebende Kenner der Science-Fiction-Literatur. Die Liste seiner literarischen, dramatischen, lyrischen, theoretischen und publizistischen Veröffentlichungen ist ellenlang.
Der Regisseur Stefan Pucher, Jahrgang 1965, brachte den Sturmwind der 90er-Jahre-Avantgarde in die Stadttheater. Er führte Ansätze von Einar Schleef und der freien Gruppen Wooster Group und Gob Squad weiter, arbeitete mit Textcollagen, Video, popkulturellen Mitteln an der Überwindung des psychologischen Realismus. 1999 erregte er die Gemüter mit einer Inszenierung von Tschechows «Kirschgarten» in Basel. Die «Sommergäste», die er nun zeigt, waren ursprünglich von Gorki als Fortsetzung des «Kirschgartens» gedacht.
Die Frage aller Fragen
Gorki hatte ursprünglich eine einfache Grundsituation entworfen: Drei Ehepaare mit ihren Freunden verbringen einige Sommertage auf dem Land. Aus dieser simplen Anlage machte er das breite Panorama der russischen «Intelligenzija», einer untergehenden Klasse, die zwar reden und reflektieren konnte, stundenlang, aber sie hatte den Sinn des Lebens, den politischen Einfluss und die Fähigkeit zu menschlichen Beziehungen verloren.
Die Aktualität dieser Modellsituation leuchtet ein: Umweltkatastrophe, Kriege, Chaos in der Welt belegen, dass unser Führungspersonal und mit ihm wir westlichen Mittelständler*innen die Herrschaft über die gesellschaftlichen Entwicklungen verloren haben. Aber reden können wir.
Dath hat die Handlung nun nach Davos verlegt, in die Nähe des Weltwirtschaftsforums, wo sich die Mächtigen treffen, die zwar gefährlich sind, aber auch lächerlich. Sie bluffen. Sie tun, als hätten sie die Entwicklungen im Griff. «Es gibt gar keine echten Chefs mehr. Das sind bloss Kühlerfiguren ohne Inhalt», heisst es einmal im Stück. Unsere «Mächtigen» als «Kühlerfiguren» – so treffend ist Daths Text oft. Und er leistet auch gedanklich einiges. Er hat ein paar wesentliche Charakteristika unserer Zeit herauspräpariert. Nur: ein Theatertext ist das nicht.

Zu den Qualitäten des Textes gehört, dass er eine bestimmte Frage ins Zentrum rückt, nämlich: Was willst du überhaupt? Das, so wird gesagt, sei die Frage, die eine Maschine der künstlichen Intelligenz nicht beantworten könne. Stimmt, ich habe es ausprobiert. Die Maschine sagt: «Als AI-Assistent habe ich keine eigenen Wünsche oder Bedürfnisse.» In Daths Stück stehen die Figuren unter dermassen grossem Präsenzstress – sie müssen ununterbrochen, Tag und Nacht, auf kommunikative Attacken schnell reagieren –, dass sie sich den Maschinen annähern und selbst nicht mehr wissen, was sie wirklich wollen.
Chef und Sklave heulen zusammen
Erhellend benennt der Text die Egozentrik und das Verlangen nach Mitleid als Grundzüge unserer Zeit. Während es in den 70er-Jahren noch gelungen sei, Verletzungen und Krankheiten «nach aussen zu drehen», das heisst in Handlungen zu verwandeln, würden heute auch kleinste Unzufriedenheiten als Krankheiten erlebt. Von den Ärzten verlange man nicht Heilung sondern Anteilnahme. Und «wenn Chef und Sklave zusammen eine Runde heulen, ist die Welt gleich viel schöner». Ausserdem könne man mit seinem Leiden andere erpressen.
So prägnant diese und andere Erkenntnisse formuliert sind, so gut manche Pointen sind («Hardware, software, Notwehr», «K.I. = Künftige Insolvenz»), Daths Text bleibt Papier. Es entstehen, mit wenigen Ausnahmen, keine scharf konturierten Figuren. Zwischen den blassen Gestalten entwickelt sich zu wenig an Beziehungen. Lange Tiraden und Exkurse müssen ins Publikum gesprochen werden. Sätze wie «Die Totenstille der unvermeidlichen Erkenntnis des illusorischen Charakters der nur noch aus Trägheit fortbestehenden gesellschaftlichen Kohärenz» kommen halt nur schwer über die Rampe.
Die Ausrichtung auf Erzählungen macht die Aufführung von der Textvermittlung abhängig, und bei einigen Spieler*innen ist keineswegs gesichert, dass das Publikum die Texte auch versteht. Die Handlung ist minim. Unverständnis und Langeweile stellen sich zeitweise ein.
Da kann man halt nix machen
Kommt hinzu, dass Dath eine heillos geschlossene IT-Welt zeigt, aus der es kein Entrinnen gibt. Widersprüche und Dialektik? Fehlanzeige. An zentraler Stelle erscheint ein Bild aus der Tradition des französischen Theoretikers Foucault: Wer aus einem Gefängnis ausbricht, landet nur in einem anderen. Das sind beruhigende Botschaften an das Publikum: Man muss nix tun, weil man nix tun kann. Aber sie entbehren der Dramatik.
Bei der Lektüre des Stücktextes glaubte ich immerhin zu erkennen, dass die Verlagslektorin von der totalen IT-Verblendung zur Sehnsucht nach einer Pause kommt. Auf der Bühne war diese Entwicklung nicht zu spüren. Ihr Schluss-Schrei kam unvermittelt.
Puchers Inszenierung rettet das eine oder andere durch popkulturelle Aufmotzung. Die bunten Kostüme erinnern von Ferne an frühere Inszenierungen des Stückes. Zwei Kontrollettis, die immer wieder feststellen, dass alles in Ordnung sei, obwohl nichts funktioniert, sind per Projektionen in lustige Figuren aus Computergames oder Comics verwandelt.
Ein verrückter Amerikaner, der durch das Stück geistert, und eine absurde «Coil gun» konstruiert, ist an sich eine profilierte, vom Autor mit einer eigenen Sprache ausgestattete Figur, die aber in ihrem grossen Monolog nicht zu Geltung kommt, weil der Darsteller die Sprache nicht plastisch machen kann. Die Explosionen der selbstgebastelten Coil gun illustriert der Regisseur per Video und bläst sie zu einem regelrechten Kriegsgeschehen auf. Mir war’s peinlich angesichts der Kriegs-Bilder in den Zeitungen.

Glänzend dagegen Vera Flück als Rapperin. Wenn sie einen Rap imitiert und persifliert, so ist das ein grosser Moment. Und Ueli Jaeggi dusterer Controller, der durch die Hinterbühne geistert und ständig am Headset klebt: Er hat es fast als einziger verstanden, die Sprache seiner Figur – der Autor hat auch ihm eine eigene Diktion gegeben – zur Geltung zu bringen. Die anderen hatten es da schwieriger, da ihre Sprachen flach blieben. Miriam Maertens’ Psychologin hatte zumindest Energie.
Der zweite Teil nach der Pause ist dichter als der erste. Das Publikum bedankte sich mit höflichem Applaus für diesen Abend, der interessant angelegt war, aber untheatralisch blieb.
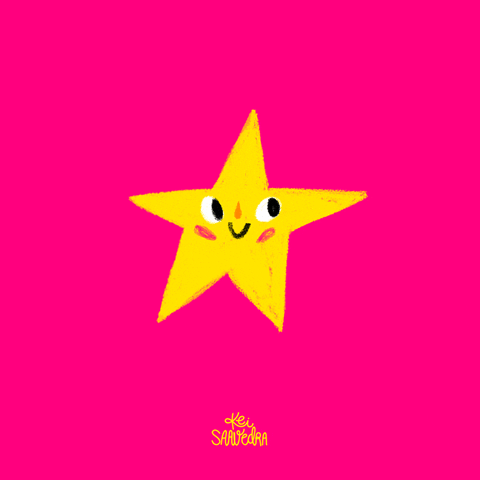
Jetzt Member werden und Bajour unterstützen.



